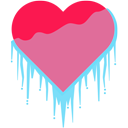Neunundachtzig Sonette lang wartet William Shakespeare mit seinem Angsttrauma, erklärt vorher unverbrüchliche, ewige Liebe und gibt den Paaren kommender Jahrhunderte bis heute romantisch-schönes Gesäusel in die Hand: den vielleicht vollendetsten Gedichtzyklus des Abendlandes.
Aber dann packt ihn die Angst. Er ist wohl, die Forscher streiten sich, gerade 28 Jahre alt, man schreibt das Jahr 1592 unter der Herrschaft Elisabeths I. Schauspieler ist er, ein Nichtsnutz und obendrein verliebt. Unsterblich. Und er schreibt: „Verläßt du mich, verlaß mich nicht zuletzt, wenn andere Leiden längst schon ausgetobt.“
Die stumme Forderung dieser Zeilen ist das erste Reglement des ungeschriebenen Kanons aller Verlassenen.
Wenn es geht, dann bitte gleich, im ersten Moment des Zweifels, damit es schnell vorüber geht, nur schnell, fleht der Poet und mit ihm jeder, der je in der Situation war oder es noch sein wird.
Als wäre das richtige Timing immer so einfach. Gar nichts ist einfach beim Verlassen, für niemanden, Ach und Krach sind da eher die Regel, Wehe und blöde Szenen, schön ist das nicht.
Dabei ist es ziemlich leicht, am Ende des 20. Jahrhunderts jemanden zu verlassen: Einfach nicht mehr ans Telefon gehen. Dauernd Migräne vortäuschen, die drei Wochen anhält. Jeden attraktiven Fremden mit entblößtem Gebiß und vorgeschobenen Hüften um Feuer bitten, vorzugsweise in Begleitung.
Die innere Ordnung des Verlassens ist unerbittlich. Am Anfang steht meist ein sehr unnötiger Satz, vielleicht der allerunnötigste: „Wir müssen mal miteinander reden.“ Und dann ist es da, das Gespräch. Irgend etwas muß sich ereignet haben am anderen Ende, etwas unendlich Kleines und unsagbar Endgültiges, etwas, das Leben verändert, verändern wird, verändert hat, etwas, das große Männer zu weinenden Kindern und schöne Frauen zu grausamen Hexen macht.
Das arme Gehirn klammert sich noch an die letzten Vertrautheiten, den Glauben an das Verschontwerden, und doch zuckt das Wissen bereits im Hinterkopf: Soeben wird man verlassen, nach allen Regeln der Kunst.
Das Verlassen hat eine ganz eigene Dynamik, eine ziemlich konsequente, einfache, immer gleiche: „Folgendes: Finito.“ Nur, daß es meistens mehr Worte braucht, manches Würgen auch und oft viel Wasser.
Interessant ist lediglich, wie man sich am besten entledigt. Und wie es eigentlich dazu kommen konnte, zum Anfang vom Ende. Der kann so ziemlich überall anfangen, der Schlawiner, irgendwo zwischen Bettzeug und „Zeig mir mal deine Kontoauszüge“, „Du warst so lange weg“ oder „Wir waren beide betrunken“. Auch schön: Ein von der besten Freundin gemurmeltes „Er war doch schon seit längerem so komisch.“ O je.
War er nicht. Sondern ist aufgestanden und hat morgens Brötchen geholt, treulich weggeschaut, wenn ihm ein unbefugter, feuriger Blick zugeworfen wurde. Hat still die Zahnpastatube zugedreht und Verständnis für die Knicke in den Zeitschriften aufgebracht. Unsägliche beste Freundinnen, nachmittagelang ertragen, deren Lebens-, Liebes- und Leidensgeschichten angehört, sie anschließend mitanalysiert und es zugelassen, daß sein bester Wein dabei weggetrunken wird. Und dann noch sein bester Whisky. Und hat sich dann nicht so gehabt.
Leise und nur mit einem Schulterzucken hat er seine Lieblingsplatte, Brahms‘ Vierte unter Knappertsbusch, von achtlosen Händen zerkratzt („Ich liebe Brahms“), in den Müll geworfen, sich ohne Widerwort vom Schwiegervater angehört, daß Carl Orff der größte deutsche Komponist aller Zeiten war. Und dabei der Mama bestätigt, wie belesen ihr Gatte sei und wie zart das töchterliche Boeuf Stroganoff und wie rosig ihr Teint noch sei, oder umgekehrt.
Aber das zählt jetzt eben alles nicht mehr, es gibt nichts zu sagen. Die nächtelangen Gespräche? Umsonst.
Wie ein Buchhalter kommt sich vor, wer alle gemeinsame Zeit zur Aktiva-Seite bilanziert und sich nur im Vorzeichen geirrt hat und alles nun als Passiva wiederfindet, jede Investition ein Verlust. Da heißt es großzügig sein und nimmermehr sich befassen und im großen Stile abschreiben und vergessen, diesen so kerngesunden Betrieb aller beider, der nun mit einem Federstrich, nein, mit dem klärenden Gespräch aus der Welt zu schaffen ist, bankrott, getilgt, ruiniert.
Verlassen so Männer Frauen? Bei Tolstoi, dem alten, weisen Russen, in „Krieg und Frieden“ zum Beispiel verläßt kein einziger Mann seine Frau, obwohl doch in den drei Bänden des wohl größten Romans aller Zeiten weiß Gott Platz genug dafür wäre. Helena dagegen, die Tochter des Prinzen Basil, will irgendwann am Ende des 28. Kapitels im elften Buch die Scheidung von Peter. „Er mag mich viel zu sehr, um mir irgend etwas abzuschlagen“, sagt sie dort – und der gerechte Tod ereilt sie dann etwas später, vorher wird ihr noch ein Bein amputiert.
Madame Bovary hält ihren armen Gatten bis zum bitteren Ende, obwohl sie ihn die ganze Zeit schändlich behandelt, die schon erwähnte Elisabeth I. läßt ihren Norfolk im Tower verschmachten bei Wasser und Brot, da kann der ihren Gunstring als Gnadengesuch zurückschicken, wie er will. Und was Gaius Julius Cäsar von seiner Ägypterin hatte in den Iden des März, der Vollidiot, konnte nicht mal Brutus ihm mehr sagen, obwohl er ihn zuletzt noch um seine Meinung gefragt haben soll.
Wenn Männer verlassen, dann heroisch, immer das Neue im Blick! Bertolt Brecht sieht den Radwechsel mit Ungeduld, weil er weiß, daß am Ziel schon die Neue wartet. „Und fragst du mich, was mit der Liebe sei, so sag‘ ich dies, ich kann mich nicht erinnern“, hat er gesagt, der Schelm.
Der Vicomte de Valmont der „Gefährlichen Liebschaften“ ist „dagegen machtlos“ einer Wette wegen. Humbert Humbert aus Nabokovs „Lolita“ schließlich heiratet die Volljährige nur um der Minderjährigen willen.
„Ich habe die Welt nicht geliebt, noch die Welt mich“, hat Lord Byron einmal geschrieben. Was für ein großartiges Thema, um jeder Zurückweisung zu begegnen, für jedes Gefühl gewappnet zu sein und trotzdem sich einlassen zu können, ob blond, ob braun, und wenn Byron es nicht wußte, wer dann?
Oscar Wilde vielleicht, der verließ alle heldenhaft, seine Frau, den schwulen Lord, das Zuchthaus und schließlich sein Leben, deswegen hatte er ja auch für alle Lebenslagen etwas Passendes: „Erfahrung ist der Name, den jeder seinen Fehlern gibt.“ Ist ja gut, Oscar.
Die Krönung des Verlassens aber ist die Trennung, um wiederzukommen, und auch die führt uns niemand besser vor als William Shakespeare. Es war sein früh angelegter eigener Wunschtraum: In dem ganzen romantisch-tragischen Schlamassel verläßt, was die meisten verdrängen, Romeo seine Julia und geht nach Mantua (aus Gründen der Strafvermeidung in Verona, weil er, man erinnert sich, Tybalt getötet hat, doch das ist jetzt wenig von Belang). Aber er verläßt Julia nur, um höchst dramatisch zurückzukehren, mit besten Absichten.
Der Rest ist bekannt, alles geht schief, und Theaterwissenschaftler, Dramaturgen wie Liebespaare werden es ihm ewig danken.
Bis zur Umsetzung unseres Journalismusfinanzierungsdekrets kann unsere Arbeit mittels eines einfachen Klicks auf den „Spenden“-Knopf gleich oben rechts unterstützt werden. Oder mit einem Einkauf in unserem Shop.